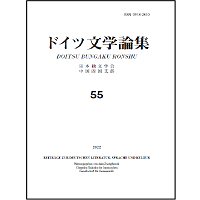
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00036692
ドイツ文学論集 32 号
1999-10 発行
中期ニーチェ研究 : 「自由精神」による「確信」からの解放
Nietzsches Befreiung von “Überzeugungen” in den Werken der mittleren Phase.
木本 伸
Abstract
Der vorliegende Text entspricht dem Expose meiner Dissertation mit demselben Titel.
Politische Ideologien wie Nazismus und Stalinismus haben zur größten Problematik des 20. Jahrhunderts, nämlich Brutalität aufgrund von Meinungen, beigetragen. Sie haben einen so großen Einfluß auf die Gedankenwelt ausgeübt, daß die wichtigsten Bücher der Nachkriegszeit diese Problematik nicht außer acht lassen können. Der Grund dafür, daß Nietzsche heute so aktuell diskutiert werden kann, liegt darin, daß er sich die Befreiung von der Metaphysik, also der Überzeugung, es gebe unbedingte Wahrheit, zum Ziel gesetzt hat, was sich im folgenden Aphorismus deutlich ausdrückt: “Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit, als Lügen. “
Nietzsche bezeichnet mit “Überzeugungen” die Ideologien, die davon ausgehen, auf einer Wahrheit zu beruhen und daher blind für die Wahrheiten anderer Ideen sind. In der zweiten Phase seiner Philosophie, die mit Menschliches, Allzumenschliches beginnt, lassen sich fruchtbare Betrachtungen über das Thema auffinden. Mein Ziel ist daher, in erkenntnistheoretischer Hinsicht zu zeigen, in welcher Weise ihm die Selbstbefreiung von “Überzeugungen” gelang.
Man klagt oft über den “Widerspruch” im Werk von Nietzsche, daß er je nach Text anderes über dieselbe Sache sage. Dagegen spricht sich doch der Denker in der Vorrede zum Genealogie der Moral für die Konsistenz seiner Philosophie aus, wonach sie gleichsam einen “Baum” darstellt, der aus dem “Grundwillen der Erkenntnis” gewachsen ist. Nach diesem Erkenntniswillen hat er tatsächlich immer Anspruch darauf erhoben, ein “guter Philologe” zu sein: Der Philologe muß sich dem metaphorischen Text “Welt” an sich annähern.
Es ist doch für Menschen fast unmöglich, Erscheinungen als solche ohne Verdrehungen zu beobachten. Hiermit stößt Nietzsche an die Grenze der Erkenntnis: “Betrachten” geht also davon aus, daß man mit “zwei Augen” Dinge sieht. Daraus folgt, daß der Gesichtspunkt selber immer unerkannt bleibt, und er hält nur die erfaßte Seite der Dinge, also eine “Überzeugung”, unvermeidlich für “Wahrheit”.
Gegen diese strukturelle Unmöglichkeit von Selbsterkenntnis ist nur eine Methode wirksam: einen dritten Standpunkt außerhalb der “zwei Augen” zu schaffen. Nietzsche fordert dazu auf: “Mach dein Theater-Auge auf, das grosse dritte Auge, welches durch die zwei anderen in die Welt schaut!” Er hat zu der Zeit, in der Menschliches, Allzumenschliches entstand, zur Vollendung der Selbsterkenntnis einen Begriff gefunden: Die “freien Geister”. Sie gibt und gab es nicht, wie der Verfasser in der Vorrede desselben Buches meint. Er hatte sie nur “zur Gesellschaft nöthig, um guter Dinge zu bleiben”, also um seinen “Grundwillen” zur Erfüllung zu bringen.
Der “freie Geist” stellt einen idealen Betrachter, der sich von allem Menschlichen befreit, dar. Daher versteht sich Nietzsche als Gegenpol zum “freien Geist”. Denn “für ein rein erkennendes Wesen wäre die Erkenntniss gleichgültig”. Der imaginäre Betrachter, das “dritte Auge” Nietzsches, schwebt ihm über den Dingen vor, damit ihm die Bilder der Dinge aus verschiedenen Perspektiven zugänglich werden.
Dementsprechend hat sich bei Nietzsche die Ausdrucksweise entwickelt: Der Aphorismus, der zum Skizzieren von Fragmentarischem bestimmt ist. Daher läßt sich auch leicht erklären, wie der sog. Widerspruch bei Nietzsche entsteht: In einzelnen Aufsätzen spiegelt sich der Schein der Dinge wider. Allein, indem man alle diese Perspektiven sammelt, kann man sich dem “Welttext” annähern.
Politische Ideologien wie Nazismus und Stalinismus haben zur größten Problematik des 20. Jahrhunderts, nämlich Brutalität aufgrund von Meinungen, beigetragen. Sie haben einen so großen Einfluß auf die Gedankenwelt ausgeübt, daß die wichtigsten Bücher der Nachkriegszeit diese Problematik nicht außer acht lassen können. Der Grund dafür, daß Nietzsche heute so aktuell diskutiert werden kann, liegt darin, daß er sich die Befreiung von der Metaphysik, also der Überzeugung, es gebe unbedingte Wahrheit, zum Ziel gesetzt hat, was sich im folgenden Aphorismus deutlich ausdrückt: “Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit, als Lügen. “
Nietzsche bezeichnet mit “Überzeugungen” die Ideologien, die davon ausgehen, auf einer Wahrheit zu beruhen und daher blind für die Wahrheiten anderer Ideen sind. In der zweiten Phase seiner Philosophie, die mit Menschliches, Allzumenschliches beginnt, lassen sich fruchtbare Betrachtungen über das Thema auffinden. Mein Ziel ist daher, in erkenntnistheoretischer Hinsicht zu zeigen, in welcher Weise ihm die Selbstbefreiung von “Überzeugungen” gelang.
Man klagt oft über den “Widerspruch” im Werk von Nietzsche, daß er je nach Text anderes über dieselbe Sache sage. Dagegen spricht sich doch der Denker in der Vorrede zum Genealogie der Moral für die Konsistenz seiner Philosophie aus, wonach sie gleichsam einen “Baum” darstellt, der aus dem “Grundwillen der Erkenntnis” gewachsen ist. Nach diesem Erkenntniswillen hat er tatsächlich immer Anspruch darauf erhoben, ein “guter Philologe” zu sein: Der Philologe muß sich dem metaphorischen Text “Welt” an sich annähern.
Es ist doch für Menschen fast unmöglich, Erscheinungen als solche ohne Verdrehungen zu beobachten. Hiermit stößt Nietzsche an die Grenze der Erkenntnis: “Betrachten” geht also davon aus, daß man mit “zwei Augen” Dinge sieht. Daraus folgt, daß der Gesichtspunkt selber immer unerkannt bleibt, und er hält nur die erfaßte Seite der Dinge, also eine “Überzeugung”, unvermeidlich für “Wahrheit”.
Gegen diese strukturelle Unmöglichkeit von Selbsterkenntnis ist nur eine Methode wirksam: einen dritten Standpunkt außerhalb der “zwei Augen” zu schaffen. Nietzsche fordert dazu auf: “Mach dein Theater-Auge auf, das grosse dritte Auge, welches durch die zwei anderen in die Welt schaut!” Er hat zu der Zeit, in der Menschliches, Allzumenschliches entstand, zur Vollendung der Selbsterkenntnis einen Begriff gefunden: Die “freien Geister”. Sie gibt und gab es nicht, wie der Verfasser in der Vorrede desselben Buches meint. Er hatte sie nur “zur Gesellschaft nöthig, um guter Dinge zu bleiben”, also um seinen “Grundwillen” zur Erfüllung zu bringen.
Der “freie Geist” stellt einen idealen Betrachter, der sich von allem Menschlichen befreit, dar. Daher versteht sich Nietzsche als Gegenpol zum “freien Geist”. Denn “für ein rein erkennendes Wesen wäre die Erkenntniss gleichgültig”. Der imaginäre Betrachter, das “dritte Auge” Nietzsches, schwebt ihm über den Dingen vor, damit ihm die Bilder der Dinge aus verschiedenen Perspektiven zugänglich werden.
Dementsprechend hat sich bei Nietzsche die Ausdrucksweise entwickelt: Der Aphorismus, der zum Skizzieren von Fragmentarischem bestimmt ist. Daher läßt sich auch leicht erklären, wie der sog. Widerspruch bei Nietzsche entsteht: In einzelnen Aufsätzen spiegelt sich der Schein der Dinge wider. Allein, indem man alle diese Perspektiven sammelt, kann man sich dem “Welttext” annähern.
About This Article
内容記述
本論は日本独文学会秋期研究発表会(1996年10月20日,大谷大学)および中国四国支部研究発表会(1995年11月11日,高知市町村共済会館)において口頭発表した原稿にもとづき,同名の学位論文(広島大学文学研究科,1998年2月)の内容を要約したものである。
権利情報
(c) 日本独文学会中国四国支部